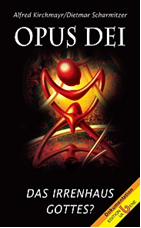
Priester und Laien im Opus Dei
(Ausschnitt aus dem Buch:
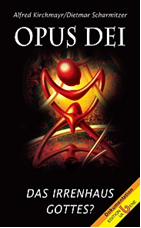
Alfred Kirchmayr/Dietmar Scharmitzer: Opus Dei - Das Irrenhaus Gottes? mit einem Gastkommentar von Dr. Walter Weiss. 256 Seiten, Format 19,5 x 12 cm broschiert
ISBN 978-3-85167-215-2 € 19,80 / SFr 33,50)
Kurz nachdem das Werk Gottes seine erste Niederlassung in Graz, eine Wohnung in der Glacisstraße, eingerichtet hatte, läutete es an der Wohnungstür. Draußen stand ein jovialer Rauchfangkehrer, der sich, wie stets, bei seinen Kunden mit einem freundlichen „Der schwoaze Moo ist doo!“ ankündigte – diesmal blieb ihm sein Spruch allerdings im Hals stecken, als ihm, in einem ganz gewöhnlichen Wohnhaus, ein Priester im Talar die Tür öffnete. Die Beziehung des Opus Dei zu seinen Priestern ist zwiespältig. Einerseits betont man den laikalen Charakter des Werkes, andererseits liebt man die Wirkung, die die traditionelle Kleidung des „Hochwürden“ hervorruft – „wegen des Respekts, den der Talar verdient“. (vgl. Nr. 9, Pkt. 7 der „Guiones doctrinales de actualidad“, der internen Abhandlung über aktuelle doktrinelle Fragen zum Thema „Bekleidungsvorschriften für Priester“) Die einzige Stelle, an der in Escrivás „Weg“ der Humor angesprochen wird, ist negativ: „Witze und Witzeleien über den Priester sind, auch wenn dir die Umstände noch so mildernd erscheinen, zum mindesten eine Ungeschliffenheit und Geschmacklosigkeit.“ (Nr. 70) Allerdings zitiert man dankbar, wenn die ernst vorgebrachten Ermahnungen mancher muttersprachlicher Spanier für Erheiterung sorgen. So rief einmal ein Prediger, der nicht wußte, daß ein Fluß im Deutschen „über die Ufer tritt“, eindringlich ins Dunkel der Kapelle: „Euer Gebet muß sein wie ein Fluß, der aus der Mutter kommt!“ Ein anderer beschwor leidenschaftlich die Arbeitsmoral seiner Zuhörer: „Wir dürfen keinen Pfutsch machen!“– Dr. Torelló wiederum lachte schallend, als er im Tagungshaus Hohewand sein Zimmer zugewiesen bekam: Damit im Tagungshaus keine Hotelatmosphäre aufkommt, heißen die Gänge dort nach Bundesländern, die Zimmer sind nach bekannten Orten benannt. Der Spanier hatte auf seinem Türschild „Kaprun“ stehen; in seiner Muttersprache heißt „cabrón“ allerdings, dezent übersetzt, „Stinkbock“.
Ein älterer spanischer Priester, der in Österreich lebt, erzählte mir, daß er vor seiner Übersiedlung in das Seminar nach Rom Dokumente unterschrieben habe, ohne sie durchzulesen; erst als er dann einmal Escrivá auf einem Gang begegnete, ihm höflich ausweichen wollte und dieser ihn mit einem freundlichen „Komm, Pfäfflein!“ vorbeiwinkte, dämmerte ihm, daß er geweiht werden solle. Wie sorgfältig Escrivá mit dem Ruf Gottes zum Priestertum bei anderen umging, sollen zwei weitere Beispiele zeigen. Boro ist Numerarier; er reist in der ganzen Welt umher, um die Altarbilder für die Kapellen des Opus Dei zu malen, und damit er die Häuser der weiblichen Abteilung betreten darf, wurde er zum Priester geweiht. Ähnlich verhält es sich mit einem Techniker, der die Druckmaschine in der Villa Tevere warten sollte. Als der von den Frauen betreute Apparat streikte, meinte der „Vater“ zu ihnen: „Wir müssen einem eurer Brüder die Soutane anziehen“. (Tapía, 227)
So oszillieren Funktion und Bedeutung von Priestern und Laien im Werk. Zwar können Laien „nur Schüler sein“ (Der Weg, 61) – als würde das Sakrament Studium und ehrliches Bemühen des Ratgebers ersetzen – dafür müssen auch die geweihten Priester – kirchenrechtlich ein Unding! – ihr „brüderliches Gespräch“ mit einem Laien führen. Beiden ist eine Rolle zugewiesen, die ihrem innersten Sein widerspricht; die Kompetenzen sind bewußt unklar gehalten, damit im Zweifelsfall immer der „Vater“ bzw. der ihn stellvertretende „Leiter“ gefragt werden muß, wer Recht hat; damit wird der Zweifelsfall zum Normalfall. „Teile und herrsche“ – dieses Prinzip war schon immer der Schlüssel, mit dem Rom die Welt im Schach gehalten hat, und das Geheimnis des Opus Dei ist vermutlich deshalb so schwer zu durchschauen, weil der legendäre „Geist des Werkes“ in der institutionellen Unlogik begründet ist. Man kann ihn nicht erlernen, er kann gar nicht kodifizierbar sein, weil er der vollkommenen Willkür entspricht: der Herrschsucht des „heiligen Gründers“, der sich selbst niemals an Regeln gebunden fühlte. Es hat auch Tradition im Werk, sehr junge – und sehr unselbständige – Numerarier in verantwortungsvolle Leitungsfunktionen zu hieven, damit die zentral ausgegebenen Direktiven in beharrlicher Sturheit durchgezogen werden. Die psychotische Doppelbindung hat System: Nie kann man sich sicher sein, das Richtige zu tun. Als ich kurze Zeit dem Werk angehörte, kam der Hinweis, wir sollten Meßbücher benützen, um uns während des Gottesdienstes besser konzentrieren zu können; einige Jahre später kam der Hinweis, die Benützung des Meßbuches soll unterbleiben, da diese Praxis wenig laikal sei.
Wie auch immer man es dreht – es paßt nicht, man hat niemals jenen Frieden, der laut Augustinus „die Ruhe der Ordnung“ ist. Man baut in kleinräumige Wohnhäuser kostbar geschmückte Kapellen ein, um „dem Herrn“ alle Ehre zu geben, man inzensiert Weihrauch für den feierlichen Segen; dann aber, weil der sakrale Geruch nicht zum säkularen Ambiente passen will, lüftet man und hängt das Weihrauchfaß zum Abkühlen aufs Klo. Das Leben der Numerarier und Assoziierten ist das Leben umgepolter Ordensleute; die „evangelischen Räte“, die klassischen Mönchstugenden Gehorsam, Keuschheit und Armut bestimmen ihren Alltag; die folgenden Untersuchungen sollen dies zeigen.
Gerne wird die Spontaneität im Umgang mit Gott als Ziel propagiert; als der Gründer einmal gebeten wurde, ein Stoßgebet zu empfehlen, reagierte er temperamentvoll: „Eine Backpfeife habt ihr verdient … Stoßgebet…? Ja, ist es denn möglich, daß ihr nicht aus dem Herzen zu einem anderen Menschen sprechen könnt? So wie mit eurer Verlobten? Was wollt ihr, – soll ich euch vielleicht zuflüstern, was ihr eurer Braut sagen könntet?“ (Bernal, 51) Die Wirklichkeit sieht anders aus. Nach einer zerknirschten Beichte empfahl mir der Priester, geistige Kommunionen als Partikularexamen zu verrichten, das heißt im Klartext, ich solle mich den Tag über besonders bemühen, mich in Gedanken mit Jesus in der Eucharistie, in der Hostie zu verbinden. Ich trug dieses Anliegen meinem damaligen Leiter vor und erzählte ihm, daß ich häufig das Gebet des Hauptmanns von Kapharnaum (vgl. Mt. 8,8) verwendete: „Herr, ich bin nicht würdig, daß du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ Mit Entrüstung schmetterte er „mein“ Ansinnen ab; wenn der Priester mir empfohlen habe, geistige Kommunionen zu verrichten, so werde es damit schon seine Richtigkeit haben; ob ich aber denn nicht wüßte, daß uns unser Vater dieses Gebet beigebracht habe: „Ich möchte Dich empfangen, Herr, mit jener Reinheit, Demut und Andacht, mit der Deine heiligste Mutter Dich empfing, mit dem Geist und der Inbrunst der Heiligen“? Dieses sollte ich verwenden, jenes bleiben lassen, auch wenn es sich um einen Text aus dem Evangelium handelte.
Dieser Leiter, der damalige Sekretär unseres Zentrums, war das Paradebeispiel eines unerleuchteten und verständnislosen „Seelenführers“. „Und worüber hast du mit dem Herrn im Gebet gesprochen?“ war die Standardfrage, mit der er indiskret und vollkommen unzulässig Woche für Woche mein Inneres durchwühlte. Nirgends in der Kirche ist diese Frage üblich, nicht einmal in den strengen beschaulichen Orden; sie pervertiert das Eigentliche, die lebendige Beziehung zu Gott, in etwas Kontrollier- und Organisierbares. Mit einem strahlenden Lächeln versuchte er seine Impertinenz zu überspielen; ohne mir über meine Gefühle, die ich mir nicht gestattete, Rechenschaft zu geben, haßte ich ihn doch aus ganzem Herzen, und wahrscheinlich habe ich es vor allem ihm zu verdanken, daß ich bei meinem Austritt an Gallensteinen litt. Die Aspekte marianischer Frömmigkeit wie das Rosenkranzgebet, die Verehrung für Marienbilder und die Liebe zur Lauretanischen Litanei habe ich lange vor meinem Beitritt gekannt und gepflegt, so wie ich sie auch jetzt noch, nach meinem Austritt und als Kontrapunkt skeptischer Intellektualität liebe und übe; ihm blieb es vorbehalten, mich im Ton des Vorwurfs damit zu quälen, ob ich denn nicht die Mutter Gottes in meinen Gebeten „Mama“ nenne. Als ich 1987 wieder einmal erkrankte und längere Zeit im Spital verbrachte, kam er nach meiner Entlassung am 31. Mai, einem Sonntagabend, in das Sommerhaus meiner Eltern nach Maria Enzersdorf, machte es mir quasi zum Vorwurf, daß ich in diesem Monat keine Wallfahrt gemacht hätte, und zwang mich, obwohl ich bettlägerig war und unter Bauchschmerzen litt, aufrecht und ohne mich anzulehnen im Bett zu sitzen und mit ihm zusammen die hundertfünfzig Avemarias zu beten.
Ich kam mit ihm so wenig zurecht, daß ich bat, die Aussprache statt mit ihm mit dem damaligen Direktor meines Zentrums machen zu dürfen; ich entwickelte erstmals Haßgefühle gegen das Opus Dei, schleuderte die Escrivá-Biographie von Berglar gegen die Wand, zerriß sie und warf sie weg, und ich dachte an einen Austritt. Da alle Anfechtungen im Bereich von Glaube, Keuschheit und Berufung sehr ernst zu nehmen waren, suchte ich den nächsten Priester des Opus Dei auf, dem ich in der Beichte meine Berufungskrise eingestand. Er beruhigte mich, empfahl mir, diese Fragen auch mit meinem Leiter zu besprechen, und gab mir die Absolution. Als ich allerdings am selben Abend, seinem Rat folgend, im Bildungszentrum Petersplatz meinem Direktor die genannten Probleme geschildert hatte, die Kapelle aufsuchte und dann, klapprig und erschöpft, aber wieder „auf Linie“ das Haus verlassen wollte, mußte ich im Flur des Erdgeschoßes noch Spießruten laufen, denn dort standen die älteren Numerarier, die im Haus wohnten, alle mit einem Glas Milch oder Fruchtsaft und einem Keks in der Hand, als „Betthupferl“ vor der abendlichen Gewissenserforschung. Nicht genug damit, daß meine Anwesenheit im Zentrum zu dieser ungewöhnlichen Stunde für alle ersichtlich machte, daß etwas Außerordentliches vorgefallen sein mußte, was mir jetzt und hier, vor versammelter Mannschaft, doch einigermaßen unangenehm war; der Priester rief mir laut und für alle vernehmbar mit seiner fast singenden, modulierenden Stimme nach: „Dietmar, verlaß mich nicht!“ Im Zusammenhang war dies allerdings nur in einer Hinsicht zu verstehen, für alle nachvollziehbar und somit ein Bruch des Beichtsiegels.